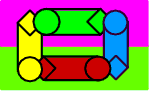Alfred Lang | University of Bern, Switzerland | 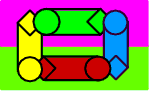 |
Conference Presentation 1985 |
Wohngemeinschaft Familie | 1985.02 |
@DwellPrax |
48 / 63KB Last revised 98.11.01 |
Vortrag an einer Tagung der Ehekommission der ev.-ref. Kirche und Christlichen Arbeitsgememenschaft für Ehe- und Familienfragen des Kt. Bern. 28.1.85. Typoskript. 14 Pp. | © 1998 by Alfred Lang |
info@langpapers.org |
Scientific and educational use permitted |
Home || |
Inhalt
Film zur Einstimmung Einleitung
1) Wohnstruktur und Familiendynamik
2) Familien und Wohnungen im Verband
3) Jugendliches Wohnen
4) Kindgemässes Wohnen
5) Das Wohnen im höheren Alter
6) Kreatives Wohnen
7) Schöner Wohnen
8) Wohnungstechnik und Wohntechnik
9) Wohnumwelt und Arbeitswelt
10) Wohnökonomie
11) Wohnungsnot?
12) Wohnerziehung, Wohnberatung, Wohnhilfe
Schlussbemerkungen
Themenliste zur Diskussion
Zur Einstimmung: Film: Mir mache Hüser - was mache die
Hüser mit Üs? (Wir machen Häuser - was machen diese
Häuser mit uns?)
(12 Min., Psychol. Inst. Univ. Bern, von Kilian Bühlmann)
Meine Damen und Herren!
Diese Tagung steht unter einem Titel, der Sie vielleicht als
Widerspruch anmutet. Unsere Kinder, wenn sie grösser werden,
früher oder später, kommen eines Tages mit dem Wunsch, mit
der Forderung, mit dem Vorwurf: jetzt ist genug Familie, jetzt ziehen
sie aus, sie wollen in eine Wohngemeinschaft.
Was haben wir falsch gemacht?, fragen wir uns dann, und wir suchen
Wege, den Auszug hinauszuschieben, bis er unvermeidlich wird. Wir
müssen die Wohngemeinschaft zugestehen, die Familie wird in die
Gerümpelkammer gestellt. Obwohl wir wissen, dass der Sohn, die
Tochter eines Tages wieder zurückkommen oder
höchstwahrscheinlich eine eigene Familie gründen wird.
Mein eigener Sohn, der lange in der Familie und an seinem
Studienort auch schon in einer WG gelebt hat, brauchte eine neue Bude
in Zürich. Eine WG würde ihm passen. Er hat ein Angebot.
Nach Strich und Faden wird er ausgequetscht, ob er wohl hineinpasse.
Was er am Wochende mache - er gehe heim in seine Familie, seine
Freundin sei auch in Bern. Dann komme es nicht in Frage, jemanden,
der so unreif sei, noch in seine Familie zurückzukehren,
könnten sie nicht brauchen. Am Wochenende sei bei ihnen der
obligatorische Seelentürk!
Der altehrwürdige Sonntagsspaziergang scheint durch den
Psycho-Marathon abgelöst worden zu sein. Ist die
Wohngemeinschaft eine Alternative oder ist sie bloss die Familie in
grün?
Im grossen Duden finde ich eine Definition der Wohngemeinschaft:
"eine Gruppe von Personen, die als Gemeinschaft (mit gemeinsamem
Haushalt) ein Haus oder eine Wohnung bewohnen". Das trifft
natürlich auf die Familie auch zu. Mit dem Begriff der Familie
dürften wir es etwas schwerer haben. Derselbe Duden macht es
sich auch etwas allzu leicht, wenn er die Familie als die
"Gemeinschaft der Eltern und ihrer Kinder" versteht und das in einer
zweiten Bedeutung als die "Gruppe aller miteinander (bluts)verwandten
Personen", d. mit dem Sippenbegriff, ergänzt. Rechtliche
Definitionen der Familie laborieren ähnlich und benötigen
dann immer wieder Ausnahmebestimmungen: für die
unvollständige Familie, für die 3. Generation, für
Adoptivkinder, für Pflegekinder, für die Stiefeltern, die
Untermieter, die auswärtigen Familienmitglieder usf. Ich will
hier nicht die biologischen, die psychischen, die sozialen, die
ökonomischen, die religiösen, die rechtlichen, die
politischen Dimensionen des Gebildes oder des Begriffes "Familie"
untersuchen - wir wollen uns ja in erster Linie um das "Wohnen" der
Familien kümmern - aber ich möchte doch auf die Wortwurzel
hinweisen: Familie hat wesentlich mit der Idee der wechselseitigen
Vertrautheit, mit dem Gewohntsein aneinander, mit familiär, zu
tun.
Und von hier mache ich einen Sprung mitten in das Wohnen von
Familien und Wohngemeinschaften: denn der Ausdruck "wohnen"
enthält ja diese Bedeutung auch: ge-wohnt. Der Ausdruck "wohnen"
hat eine indogermanische Wurzel "uen" = verlangen, lieben, anstreben;
und daran schliesst sich eine eigenartige Gruppe von Bedeutungen an:
ge-winnen (durch Einsatz etwas erreichen), Wahn (Hoffnung,
Erwartung), Wunsch, Wonne (also das Gewonnene, auch die Lust),
Gewohnheit (mit dem man vertraut ist); und zudem besteht ein
Zusammenhang mit der Wortgruppe "bauen". Ich vereinfache: Bauen ist
transitives be-wohnen, wohnen-machen, Gewohnheit oder Vertrautheit
oder "Familien" machen, wenn man so will. Und was hier auf der Ebene
der Sprache so einen faszinierenden Bedeutungskomplex bildet,
möchte ich inhaltlich präzisiert in eine These formulieren,
die den Kern meines Denkens über Wohnen darstellt:
In meinem Verständnis ist Bauen ein Versuch der Menschen, die
andern Menschen und sich selbst ge-wohnt zu machen, das heisst dazu
zu bringen, dass sie vertraut sind, dass sie vorhersagbar werden,
dass sie verlässlich werden. So gesehen ist das Gebaute eine Art
Gedächtnis. Ein Gedächtnis, das für einem selbst und
für die andern überdauernd einen Rahmen für das
Handeln setzt. Das Gebaute ist nicht nur viel dauerhafter als des
flüchtige Erinnern, das wir im Kopf haben. Es ist auch mehreren
Menschen gemeinsam, ist also ein kollektives, oder soziales
Gedächtnis. Das Gebaute ist demnach ein Vorläufer der
geschriebenen Sprache, der Schrift. Nicht ein Archivgedächtnis,
sondern ein Aktivgedächtnis, eines von dem Wirkungen ausgehen.
Das Bauen nimmt ganz besonders jenen Teil der Sprache vorweg, der den
Andern, auch einem selbst, zur etwas bringen will, es hat mit dem
"Verschreiben", dem Anweisen zu tun hat. Mir boue Hüser - was
mache die Hüser mit üs? Ein anderer Teil des Bauens ist
verwandt mit dem Kleiden: seht her, das bin ich, das sind wir!
Wie alle Sprachen folgt natürlich auch das Bauen gewissen
Regeln. Wir können durch Analyse des Bauens und des Umgangs mit
dem Gebauten, des Wohnens, diese Regeln explizit machen, was dabei
herauskommt ist eine Art Wohnbau-Grammatik. Derzeit sind wir weit
davon entfernt, diese Vokabular und Grammatik dieser Sprache
ausformulieren zu können, was wir haben sind Fragmente und
Vermutungen.
Ich versuche beispielhafte Elemente dieser der Bausprache an
protypischem Bauen zu verdeutlichen. Sie können dass vielleicht
konkret auf dem Hintergrund der Evolution des Menschen sehen: Sie
wissen, dass ein beträchtlicher Teil der Regulation der
innerartlichen sozialen Beziehungen zwischen Tieren durch Instinkte
erfolgt. Weil die Ernährungsbasis der meisten Lebewesen
räumlich verteilt ist, ist diese soziale Regulation auch eng mit
dem Raum verbunden: wir sprechen etwa von der Territorialität
der Tiere. Beispiel: das Vogelpaar oder die Schimpansengruppe, auch
der Hofhund, die ihr Revier verteidigen, am Rand mit Duftmarken
markieren. Beim Menschen mit seiner übersteigerten
Verhaltensflexibilität sind solche Instinkte zwar wohl noch
wirksam, aber nicht mehr in Reinform, sondern abgeschwächt und
kulturell überlagert. Stellen Sie sich vor, zwei Menschen oder
zwei Menschengruppen kommen auf die Idee, ihre räumlichen
Auseinandersetzungen, Beziehungen überhaupt, zu erleichtern,
indem sie zwischen sich einen Zaun oder eine Mauer errichten. Das ist
eine viel sichtbarere Duftmarke, und einigermassen dauerhaft. Sie
markiert eine Abgrenzung voneinander. Und zudem verbindet elegant. Am
Zaun, jeder auf seiner Seite, kann man sich nämlich risikoloser
begegnen als auf dem freien Feld; der Zaun, die Mauer ist ein
Hindernis, hemmt buchstäblich das unvermittelte
Aufeinanderlosgehen und wird damit zum Verbindenden.
Haben Sie schon Nachbarn in Reiheneinfamilienhäusern
stundenlang am Zaun schwatzen sehen? Und die menschenleeren
Rasenflächen, wenn sie sich darauf geeinigt haben, der
Ästhetik zu ihrem Recht zu verhelfen, die Zäune
auszureissen und den Raum zwischen den Häusern vom
Gartenarchitekten perfekt bepflanzen zu lassen? Diese Gruppe von
Bewohnern hat dann nach aussen gezeigt, dass sie mit der Zeit gehen
und es sich leisten können, eine unnützliche
Rasenfläche zu pflegen; sie haben nur übersehen, dass sie
die Pflege der Beziehungen innerhalb der Nachbargruppe erschweren.
Der Zaun, die Mauer ist eine ungeheure Errungenschaft des
menschlichen Zusammenlebens, er trennt und verbindet.
Hat man einmal den Zaun, die Mauer, dann ist eine noch genialere
Erfindung das Fenster oder die Tür, die man auf und zu machen
kann. Damit ist zur Raumstrukturierung als Regulator der Beziehung
noch die Strukturierung der Zeit gekommen. Die Nacht ist ist dann
nicht einfach nur mehr ein Naturereignis, sondern ein Element der
Kultur: jetzt schliessen wir die Läden und jetzt machen wir sie
auf; jetzt haben wir Nacht, auch wenn es mitten am Tag ist. Jetzt
schliessen wir die Vorhänge, und dann sind wir für uns -
jetzt öffnen wir sie, dann könnt ihr draussen von unserem
Leben einen Blick erhaschen.
Oder ein anderer Prototyp: das Podium, die Nutzung der dritten
Dimension. Man nehme dem König oder dem Präsidenten sein
Podium weg, und er ist nur noch ein halber Präsident. Dass die
Lehrerpodien aus den Schulstuben ziemlich weitgehend verschwunden
sind, ist ein aufschlussreicher Indikator für das
ausgeglichenere Verhältnis, das die Lehrer zu den Schülern
suchen (wollen oder sollen? - und allerdings zumeist noch nicht
gefunden haben).
Zurück zum Wohnen: Sind Sie mit mir einverstanden, dass ein
weitverbreitetes Unbehagen beteht über unser Wohnen? Und es hat
in letzter Zeit noch deutlich zugenommen. Seit dem zweiten Weltkrieg
hat sich in der Schweiz die pro Person verfügbare
durchschnittliche Wohnfläche ungefähr verdoppelt, von etwa
20 qm auf über 40 qm. Umfasste 1950 der Durchschnittshaushalt
noch 3.68 Personen, so ergibt die Volkszählung 1980 einen Wert
von 2.55. Von den fast 2.5 Mio Wohnungen für die knapp 6.5 Mio
Einwohner fallen je ein knappes Drittel auf Einpersonenhaushalte,
Zweipersonenhaushalte und Drei- oder Vierpersonenhaushalte. Ganze 9%
der Haushalte umfassen 5 oder mehr Personen. In den grossen
Städten ist die Situation noch extremer: die
Durchschnittsbelegung pro Wohnung beträgt hier 2 Personen und
der Anteil der Einpersonenhaushalte beträgt hier zwischen 42 und
48%. Reden wir nicht von Zweitwohnungen; auf die Einsamkeit komme ich
zurück. Dennoch spricht man immer noch von Wohnungsnot, und dies
gerade in den grossen Städten!
Was ist los mit unserem Wohnen, dass wir immer mehr und immer
grösser wollen: Geht es uns wie jemandem, der sich einseitig
ernährt und immer mehr isst, um wenigstens ein bisschen von dem
zu bekommen, was ihm seine Diät nicht bietet? Ziehen unsere
grossen Kinder auch in die Wohngemeinschaften, weil sie von den
Familienwohnungen nicht das bekommen, was sie brauchen? Scheitern die
meisten Wohngemeinschaften unter anderem deshalb, weil sie von den
verfügbaren Wohnungen auch nicht jene Unterstützung
bekommen, die jede Lebensgemeinschaft braucht?
1) Wohnstruktur und
Familiendynamik
Die Wohnung ist ein "Gefäss" für die Familie, habe ich
einmal formuliert, eine Art materieller Träger, eben das
niedergelegte soziale Gedächtnis und Stuerungsinstrument
für eine Lebensgemeinschaft. Vergleichen wir die Familie mit dem
Individuum, so wird die Schwäche der Gruppe deutlich: das
Individuum hat seinen Organismus, den realen Träger seiner
Existenz. Im individuellen Gedächtnis (in seinem Hirn auf
wunderbare Weise niedergelegt) verfügt es über eine Spur
seines Lebens, kann durch Erinnern darauf zurückgreifen, gewinnt
so seine einzigartige Existenz. Natürlich nehmen viele Teile des
individuellen Gedächtnisses auf den sozialen Aspekt seiner
Existenz bezug. Aber die soziale Existenz des Menschen braucht einen
mächtigeren Träger, der gewissermassen ausserhalb oder
zwischen den Individuen allen zugänglich ist, ja sogar sich
allen aufdrängt, permanenter als eine soziale Lehr- oder
Kontrollinstanz. Die Kultur als der Ausdruck unserer sozialen
Existenz schlägt sich in Ideen und aber vor allem in gestalteten
Objekten wieder. Davon sind die Kunstwerke nur die Spitze des
Eisbergs; die Hauptsache sind die Alltagsobjekte und ganz besonders
eben das Gebaute, das über lange Zeit hinweg stabil bleibt und
uns allen seinen Prägestempel aufdrückt. Das
Häuserbauen muss also als Teil eines Kreises verstanden werden,
gleich wie wenn Menschen auf Menschen wirken, nur über einen
Umweg, und damit dauerhafter. Mit bestimten Bauformen
begünstigen oder behindern wir immer ganz bestimmte Formen des
gemeinschaftlichen, familiären Lebens.
Es ist eigenartig: wir haben, in der Schweiz und anderswo, eine
hochentwickelte Forschung über den Wohnungsbau, also wie wir
Häuser bauen. Aber wir haben die andere Hälfte des Kreises
vergessen: wie die Häuser auf uns wirken.
Es ist in diesem Rahmen nicht möglich, eine umfassende
Theorie des Wohnens als menschliche Tätigkeit ersten Ranges zu
geben. Einen Grundgedanken aber sollte ich daraus skizzieren: Wohnen
überbrückt die Spannung zwischen dem Privaten und dem
Öffentlichen. Das Gebaute erleichtert dem Menschen zugleich
Individuum und Sozialwesen zu sein. In der Wohnung kommt diese
Spannung und diese Brücke im Verhältnis zwischen dem
eigenen Zimmer und dem gemeinsamen Räumen (Wohnzimmer,
Küche, Eingang) zum Ausdruck; auch zwischen noch privateren oder
intimeren Teilen der Einrichtung (Bett, Schrank, Schublade) und dem
für die andern Zugänglichen. Auf einer
nächsthöheren Stufe des sozialen Verbandes finden wir
wieder diesen Spannungsbezug: die Familie oder die Wohngruppe als
Einheit in ihrer Wohnung, in ihrem Haus hat einen Übergang zum
Öffentlichen, zur Strasse, zum Platz.
Ich will Ihnen nun mit Beispielen solche Zusammenhänge zu
verdeutlichen versuchen.
2) Familien und Wohnungen im
Verband
Ich greife zuerst noch einmal auf den Film zurück, auf das
dritte Beispiel: längi Gäng verbinde Zimmer aber trenne
d'Lüt. Die Forschung bezieht sich auf amerikanische
Studentenwohnheime. Wie sicher wir sie auf das hiesige Wohnen von
Familien übertragen dürfen, können wir noch nicht
beweisen; es gibt aber eine Reihe von Indizienbelegen dafür.
Eine der gut belegten Erkenntnisse der Wahrnehmungs- und der
Sozialpsychologie kann man in die Regel der optimal kleinen Zahl
zusammenfassen: es gibt ein Optimum bezüglich der Menge der
Information die wir verarbeiten können: zu wenig ist nicht gut,
weil dann der Wahrnehmende aus eigenem ergänzt, fabuliert; und
zuviel ist nicht gut, weil dann die Qualität der Verarbeitung
abnimmt. Dies gilt sozialpsychologisch auch für die Pflege der
Beziehungen zu den andern. Natürlich ist eine allgemeine Angabe
des Optimums als Zahlenwert nicht möglich, immerhin finden sich
in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder Werte im Bereich
zwischen 5 und 10. Das erinnert an klassische Familiengrössen.
Und Familien können sich in Verbänden gruppieren, etwa im
Gehöft im Weiler; in der Stadt als Nachbarschaft, als Gasse, als
Siedlung. Und Nachbarschaften gruppieren sich zu Dörfern,
Quartieren, diese zu Stadtteilen, Städten usf. In dieser
Gliederung der gebauten Welt kommt eine Parallele zur menschlichen
Beziehungskapazität zum Ausdruck.
Man muss feststellen, dass unser Bauen auf die Regel von der
optimal kleinen Zahl längst nicht mehr Rücksicht genommen
hat, sondern hybride Riesengebilde hervorgebracht hat; nicht nur
Überbauungen wie das Murifeld oder La Defense bei Paris haben
das menschliche Mass längst gesprengt. In einem Haus mit 20
Stockwerken und je 4 Wohnungen begegnet man in der Eingangshalle
potentiell einem mehr als 200 Leuten. Niemand kann 200 Nachbarn
haben. In dem was die Studenten erleiden, welche zu dreissig zusammen
zu wohnen gezwungen sind, sehen wir modellhaft, was den Leuten in den
grossen geplanten Quartieren geschieht. Fragen wir sie, warum sie in
ihrem Quartier zufrieden sind, so ist die wichtigste Begründung,
dass sie hier so recht anonym leben können: die andern
kümmern sich nicht um sie und sie brauchen sich nich tum die
andern zu kümmern. Ich will nicht verhehlen, dass
Dorfgemeinschaft eine Belastung sein kann, der man besonders in
gewissen Lebensphasen zu entgehen versucht. Man muss aber bedenken,
was das anonyme Wohnen mit sich bringt. Infolge der übergrossen
Zahl der sich aufdrängenden Beziehungen zieht man sich auf sich
selbst zurück: man ist nicht mehr fähig, Beziehungen
einzugehen und zu pflegen, wie dies bei den Studenten sichtbar wird.
Das stellt man bald einmal auch selber fest, und um sich vor sich
selbst zu rechtfertigen, erklärt man, man wolle ja gar nicht
Beziehungen haben, man suche die Anonymität. Wenn man die
Trauben nicht haben kann, dann sind sie eben sauer. Die Vereinsamung
in der Wohnung ist vorprogrammiert. Während sie der arbeitende
Mann teilweise am Arbeitsplatz kompensieren kann, ist der Druck der
Baute auf die Frau umso grösser. Ich bin überzeugt, dass
Versuche der Selbstverwirklichung der Frauen über den
Arbeitsplatz eine wesentliche Wurzel in unserer Bauweise haben.
Ich möchte betonen: es kommt mir nicht auf die amerikanischen
Studenten in ihren speziellen Wohnheimen an. Was ich aus diesen
Untersuchungen abstrahiere, ist eine Lebenssituation, die wir in
mancherlei Konkretisationen auch bei uns wiederfinden können: Da
sind in den Korridor-Studenten Menschen exemplifiziert, welchen durch
die Bauweise und die damit bestiammte Lebensform ein schroffer
Übergang vom Privaten ins Öffentliche aufgezwungen ist; es
gibt für sie kein Zwischenbereich zwischen "allein" und "mit
vielen". Die Wohnungs-Studenten jedoch leben in drei Bereichen:
allein, mit wenigen zusammen, in der Öffentlichkeit; das gibt
ihnen diese auffällige Stärke und Sicherheit im
öffentlichen Bereich, während die Korridorstudenten die
vielen andern als Bedrohung erfahren und in die Defensive gehen.
Eine der Untersuchungen bei den amerikanischen Studenten muss ich
Ihnen auch noch berichten. Die Studenten aus den Korridorheimen und
aus den wohnungsartigen Heimen wurden zu Spielen in Gruppen
zusammengebracht. Es waren Spiele, bei denen man Koalitionen bilden
oder gegeneinander spielen kann wie bei gewissen Jass-Formen. Wenn
man gegeneinander spielt, kann man theoretisch viel gewinnen, aber
die Wahrscheinlichkeit ist klein. Wenn man miteinander spielt,
gewinnt man weniger spektakulär, aber mit grösserer
Wahrscheinlichkeit, und man muss den Gewinn natürlich teilen.
Kooperativ spielen setzt voraus, dass man sich in den andern
versetzen kann, dass man davon ausgeht, dass auch der andere an einer
differenzierten Beziehung interessiert ist. Ich kann Ihre Erwartung
bestätigen, dass die Wohnungs-Studenten mehrheitlich kooperativ
spielen, die Korridorstudenten mehrheitlich kompetitiv, d. die
Korridorstudenten sehen nur sich selbst und ihren Gewinn; sie geben
dann auch früher auf, wenn nichts herausschaut. Das sind
Erkenntnisse, die unter die Haut gehen; auch dann wenn man sie
zurückhaltend interpretiert. Der soziale Wohnungsbau
insbesondere, der die grossen Wohn-Komplexe stark gefördert hat,
erweist sich im Wortsinn als asozial, wie A. MITSCHERLICH schon 1965
gesagt hat.
3) Jugendliches Wohnen
Zwischen den Eigenschaften der gebauten Welt und den
Beziehungsmöglichkeiten der darin lebenden Menschen besteht also
eine Abhängigkeit. In gewissem Sinne kann man eine Entsprechung
fordern, bzw. feststellen, dass sie alzu oft nicht erfüllt ist
in unserem heutigen Bauen. In unserem ersten Beispiel war es die
gestufte Gruppierung von Menschen (Familie, Nachbarschaft etc.) und
Bauten (Wohnung, Haus, Häusergruppe oder Gasse, Siedlung,
Quartier etc.). Ich meine nicht, dass Beziehungsstruktur und
Raumstruktur einander voll kongruent sein sollen; aber eine
prinzipielle Entsprechung ist wohl sinnvoll, auf welcher dann
fruchtbare Spannungsverhältnisse entstehen können. Im
zweiten Beispiel untersuchen wir ein solches Spannungsverhältnis
zwischen konstanten Räumen und sich ändernden Menschen,
eines das heute oft ein Überspannungsverhältnis wird, nicht
ohne Grund. Ich meine das Wohnen der Jugendlichen. Hier kommt in der
Sprache des Bauens so richtig unser wahres Verhältnis zur Jugend
zum Ausdruck, nämlich die Ambivalenz des grossen Versprechens
und seine Nichterfüllung. Gestatten Sie, dass ich bei diesem
Thema ausgehend von unseren Befragungen von Jugendlichen in ihrer
Wohnung über das Beweisbare hinaus interpretiere.
Das Wohnen der Familien war über Jahrtausende durch Enge
gekennzeichnet. Abgesehen von den kleinen Oberschichten lebten die
meisten Leute praktisch in einer Kammer. Das bedeutet, dass ein
wesentich grösserer Teil der zwischenmenschlichen Interaktionen
nicht durch räumliche Regulatoren bestimmt war, sondern durch
direkte Interaktion und Disziplinierung. Durch den Wohlstand und die
Freizeit und die Bildung haben wir den Jungen in unserem Teil der
Welt den Himmel auf Erden versprochen, sichtbar etwa im Anspruch auf
das eigene Zimmer, das ausser in den nicht mehr sehr zahlreichen
Grossfamilien, weitgehend Wirklichkeit geworden ist. Wir haben aber
diese eigenen Zimmer so gebaut, dass das implizite Verprechen auf die
eigene Persönlichkeit gerade wieder durgestrichen wird. Denn
diese kleinen, einerseits abgeschlossenen, anderseits so
(schall)durchlässigen Kästchen, in die wir unsere Jungen
sperren, taugen eigentlich fast zu gar nichts. Von den Erwachsenen
ist vorgeplant, was man darin zu tun hat: schlafen, Aufgaben machen;
zum Spielen sind sie in der Regel schon zu klein. Ändern darf
man sie nicht wegen der Renovationskosten; im Murifeld zB taugen die
Betonwände nicht einmal zum Aufhängen von Postern: zu hart
zum Nägel einschlagen. Ferner drückt die Anordnung der
Kinderzimmer im Wohnungsgrundriss aus, wie das Verhältnis
zwischen Eltern und Kind zu verstehen ist: was für Kleinkinder
sinnvoll ist, eine direkte Unterordnung, ist für den
Jugendlichen kontraproduktiv: er soll ja, das erwartet man von ihm
ein selbständiger Mensch werden; aber mit dem Grundriss der
Wohnung sagt man ihm dauernd: du bist da ein Anhängsel von uns
Eltern. Der meist eine grosse Wohnraum gehört nach
Möblierung und Lebensgewohnheiten den Eltern. Haben Sie auch
schon beobachtet, wie ihn die Jungen, wenn man ein paar Tage weggeht,
mit Beschlag belegen, und sich dann wieder zurückziehen. Vor dem
2. Weltkrieg boten die meisten städtischen Wohnblöcke
wenigstens Mansarden; die "Eroberung" der Mansarde war bei meinen
Altersgenossen ein lebenswichtiger Akt der Selbstwerdung, den wir der
jüngeren Generation aus irgendwelchen ökonomischen
Gründen auch noch weggenommen haben.
Ich sage nicht, das eigene Zimmer für die Jungen sei nicht
eine Errungenschaft; ich meine bloss, es sei eigentlich nur eine
halbe Errungenschaft, nämlich, so wie wir es anwenden, ein
Emanzipierten-Unterwerfungsmittel. Natürlich sollen sie
ausziehen, aber muss es mit so viel Illusionen sein und in
räumliche Verhältnisse die zur Wiederholung desselben
Unsinns geradezu nötigen. Ich komme beim "kreativen Wohnen" auf
Alternativen zurück.
4) Kindgemässes Wohnen
Auch über das Wohnen der Kinder wäre allerhand
BÖses zu sagen. Die Zwänge des Hochhauses haben Sie schon
im Film gesehen. Ich möchte betonen: es geht mir nicht darum,
das Wohnhochhaus an sich schlecht zu machen. Ich weiss nicht, ob Sie
sich erinnern: zu Beginn der Fünfziger Jahre, als die ersten
gebaut wurden, ist man zur Besichtigung hingepilgert, wie etwas
später auf die Autobahnbrücken; und jetzt wollen Einige,
dass das eine wie das andere geächtet wird. Auch das
Wohnhochhaus hat seine Funktion: vermutlich produziert es zur
Hauptsache geduldige, abhängige, leicht lenkbare,
beziehungsschwache Menschen. Die Frage ist nur, ob wir das wollen
oder unter Umständen wer das will. Zumindest eine Lüge ist
nachweisbar: die 15 Mio Menschen, die nach den Erwartungen der
frühen sechziger Jahre die Schweiz einmal bevölkern
sollten, hätten nur in Hochhäusern Platz; ein Blick auf die
Ausnützungsziffern, die ja bei Hochhäusern nicht höher
sind als bei andern Überbauungen, hätte sie widerlegen
können. Aber fast alle haben es geglaubt, von links und von
rechts. Vielleicht machte eben die Hochhausbausprache Gedichte,
welche der Zeit Ausdruck gaben; und weil keine umfassende
Wohnbaugrammatik verfügbar war, konnte man diese Gedichte nur an
der Oberfläche deuten.
5) Das Wohnen im höheren
Alter
Das Wohnhochaus hat sich als förderlich erwiesen für den
Lebensmut Betagter aus städtischen Verhältnissen, die sich
im Hochhaus mit einem einzigen, Tag und Nacht bewachten Eingang mit
Recht sicherer fühlen können als anderswo. Das belegen
Untersuchungen aus amerikanischen Grossstädten mit extrem hoher
Kriminalität. Zugegeben, eine etwas besondere Situation; aber es
gibt sie. Bei uns ist dies ein weniger dringendes Problem, jedenfalls
bis heute; und so haben wir Betagtenheime eher ebenerdig, mit
Zugäng zur Natur gebaut. Der Alterswohnungsbau ist aber dennoch
ein Musterbeispiel dafür, dass der menschliche Bautrieb sich
fast immer austobt, bevor wir eingehend über seine Folgen
nachgeforscht und nachgedacht haben. Nach rund 20 Jahren intensiven
Altersheim-Bauens in allen Gemeinden setzt sich die Erkenntnis durch,
dass die Unterbringung der Betagten in besonderen Bauten im Prinzip
das Mittel der Wahl ist, ihnen den Lebenssinn und oft auch den
Lebensmut wegzunehmen. Es scheint, dass wir durch unser Bauen mit
ähnlicher Brutalität in das Leben unserer Mitmenschen
eingreifen wie in die Schönheiten der Landschaft. Beides zudem
mit der Begründung sozialer Gesinnung.
Leben die Betagten in ihrer normalen Umgebung, so haben sie,
zumindest unter gewissen Voraussetzungen eine Chance, auch im hohen
Alter ein sinnvolles Leben zu führen. In einer Untersuchung
haben wir die Beziehungsnetze und das Gruss- und gegenseitige
Hilfeverhalten von alleinstehenden betagten Frauen in einem geplanten
Hochhausquartier und in einen gewachsenen Berner Vorstadtquartier
verglichen. Die Ergebnisse bestätigen Einsichten, die sich in
der Betagtenbetreuung neuerdings zunehmend durchsetzen, nämlich
die grosse Bedeutung der vertrauten und überschaubaren und
durchmischten Wohnumgebung für das Wohlbefinden und die
andauernde Selbständigkeit der Betagten. Die Beziehungsnetze in
der kleinräumigen Siedlung umfassen das ganze Quartier, in der
grossräumigen praktisch nur das eigene Wohnhaus. Die Gesamtzahl
der Bekannten ist zwar nicht unterschiedlich, aber offensichtlich
besteht im kleinräumigen Quartier ein ungleich intensiveres
Beziehungsnetz: beispielsweise gaben im Hochhausquartier 42% der
Befragten an an, keine engeren Freunde zu besitzen, während es
im älteren Stadtquartier nur 5% waren.
Ähnlich wie die Mansarde bei den Jugendlichen ist das
"Stöckli"-Prinzip bei den Älteren eine Errungenschaft, die
wir vermutlich zu Unrecht aufgegeben haben. Es gibt schöne
Beispiele phantasievollen Bauens, die solche Konzepte neu
beleben.
6) Kreatives Wohnen
Im Film haben wir eine ältere, gewachsene Wohnumgebung dem
geplanten, sterilen Rasen und Beton der Moderne
gegenübergestellt. Vielleicht hätten wir eine der neueren
kreativen Wohnüberbauungen wählen sollen, die die Bewohner
ebenfalls als Einzelne und als Gruppe herausfordern, ihren
Wohnbereich aussen und innen immer wieder erneut ihrer eigenen
Entwicklung als Individuum, als Familie, als Nachbarschaft anzupassen
und vorauszuwerfen. "Entwurf", die klassische Bezeichnung des
Herzstücks der Tätigkeit des Architekten, enthält ja
diese Idee: vorauswerfen, gemeint ist wohl: um dann nachzugehen. Die
Bedeutung hat sich mit der Professionalisierung des
Architektenstandes eingeengt auf das Verhältnis zwischen
Zeichnung und baulicher Ausführung; die tiefere Bedeutung
könnte sein, dass der Bauende im Gebauten einen Entwurf seiner
und seiner Gemeinschaft Zukunft vorauswirft, in dessen Realisierung,
dem Wohnen, dann die Entwicklung stattfindet. Bauliche Entwürfe
binden das Leben dieser Gemeinschaft über die Bautradition
zugleich in eine grössere Gesellschaft und in deren Geschichte
ein.
Solches Entwerfen und Entwickeln setzt voraus, dass ein
günstigeres Verhältnis zwischen Konstanz und Wandel gesucht
wird. Während Jahrtausenden war in unserer Zivilisation die
stabilisierende Wirkung des Gebauten auf den Menschen im Vordergrund;
langsam zogen die Bautraditionen mit der kulturellen Evolution mit.
Seit einem Jahrhunderten etwa verstehen sich die Baufachleute als
Pioniere. Architekten versuchen sich in Gesellschafts-Utopien, an
ihrem Bauen soll die Menschheit genesen. Die übersteigerte
Technisierung des Bauens wirft die Traditionen auf den Abfallhaufen
und nimmt zugleich dem Benützer, dem Bewohner das Bauen aus der
Hand und übergibt es dem Experten. Der Bewohner wird zum
Konsumieren gezwungen, wo er eigentlich in seine Zukunft und die
Zukunft der Seinen investieren möchte.
Die Arbeitsteiligkeit belegt auch die Kreativität mit
Beschlag und behält sie dem Fachmann vor. Die Baugesetze und der
Konformitätsdruck nehmen den letzten Rest; man kann sie auch als
Versuch auffassen, den überbordenden Wandel zu stabilisieren.
Das schafft eine paradoxe, schwer zu verkraftende Situation: von
hohem Wert ist zugleich das Festhalten am Alten, weil stabilisierend,
und das Kreative, Originelle, mit dem der Einzelne sich selbst
entwirft. Wir haben einmal versucht, Schrebergarten-Architektur zu
untersuchen, um den Gestaltungswillen der Benützer am Werk zu
sehen. Dies in der Erwartung, dass geringer Umfang und tragbare
Kosten der Projekte diesen manifest machen würden. Die
Enttäuschung war gross, als wir feststellen mussten, dass
Vorschriften und Konformitätsmentalität in diesem Bereich
noch fast totaler sich durchgesetzt haben als im Wohnungsbau.
7) "Schöner Wohnen"
Vieles von dem, was im Zusammenhang mit Kreativtät gesagt
wurde, lässt sich auf die Verwechslung verschiedener
Bewertungskriterien zurückführen. "Gut" sei gleich
"schön" sei gleich "kreativ" sei gleich "richtig". In der
Psychologie der individuellen Unterschiede sprechen wir gelegentlich
vom Halo-Effekt, der Ausstrahlung, die eine Eigenschaft eines
Menschen auf die Wahrnehmung seiner anderen Eigenschaft ausübt.
Da stellen wir fest, dass wir von einem schönen Menschen ohne
weitere Überprüfung auch anzunehmen geneigt sind, dass er
intelligent, tüchtig, geschickt usw. sein müsse. Die
Baufachleute haben sich dieses Mechanismus in fast schamloser Weise
bedient; die Perversion davon, die den Architekten selber den
Schrecken einjagt, erscheint dann in bunten Zeitschriften unter
Titeln wie "Schöner Wohnen" oder das "Ideale Heim". Die neueste
Zeit hat diesen Bewertungskomplex noch um zwei Komponenten erweitert:
gut und schön ist natürlich auch pflegeleicht und technisch
perfekt.
Aber "schön" ist überhaupt nicht notwendig auch "gut",
und alle andern Komponenten können durchaus je verschieden
positiv sein. Für wen denn "schön" und wozu "gut"? Die
Frage wird in der Regel überhört. Es müsse doch ein
Allgemeingutes und ein Allgemeinschönes geben. Obwohl der
klassische Bildungskanon diese Erwartung unterstützt hat, ist
sie deshalb nicht weniger falsch.
Die naheliegende Antwort ist vielleicht: der Bewohner selber ist
die letzte Instanz; also Populismus der Architektur. Diese Antwort
wäre so problematisch wie die des Ästheten: ich weiss, was
schön ist, und die andern haben es mir gefälligst
abzunehmen. Wenn Bauen eine Sprache zur längerfristig angelegten
Kommunikation und Interaktion zwischen den Menschen ist, dann werden
wir uns wohl etwas differenziertere Kriterien der
Architekturbewertung aneignen müssen. Dann ist die
Ästhetik, die Schönheit des Baugedichts mit dem Inhalt ins
Verhältnis zu setzen, mit dem, was das Gebaute berichtet und
bewirkt. Und auch die Funktionalität des Zweckbaus muss es sich
gefallen lassen, auf Nebenwirkungen, auf verborgenen Sinn, untersucht
zu werden. Vielleicht muss die Beurteilung der Architektur, ob gut
oder schlecht, ob schön oder hässlich, überhaupt
einmal zurücktreten hinter die Untersuchung dessen, was zwischen
dem Gebauten und den es brauchenden Menschen geschieht. In den
Benützungsspuren und den Veränderungsversuchen, den
gelungen und den misslungenen, steckt ein grosser Schatz von Weisheit
über Mensch-Umwelt-Bezüge, den wir noch kaum begonnen
haben, auszuschöpfen.
Ich habe eine Vermutung, noch nicht zu Ende gedacht, ich
möchte Sie Ihnen als Denkanstoss mitgeben. Vielleicht meinen wir
mit "schön", "gut" usf. in diesem Zusammenhang ganz einfach
"öffentlich", "anerkannt". Bauen ist ja, haben wir festgestellt,
gemeinsames Gedächtnis,in Überspannungsverhältnis
wird, nicht ohne Grund. Ich meine das Wohnen der Jugendlichen. Hier
kommt in der Sprache des Bauens so richtig unser wahres
Verhältnis zur Jugend zum Ausdruck, nämlich die Ambivalenz
des grossen Versprechens und seine Nichterfüllung. Gestatten
Sie, dass ich bei diesem Thema ausgehend von unseren Befragungen von
Jugendlichen in ihrer Wohnung über das Beweisbare hinaus
interpretiere.
Das Wohnen der Familien war über Jahrtausende durch Enge
gekennzeichnet. Abgesehen von den kleinen versucht. Ein verzweifelter
Versuch einer Zeit, die dem Wertpluralismus frönt?
8) Wohnungstechnik und
Wohntechnik
Ich habe schon auf die blühende Wohnungsforschung und die
fehlende Wohnforschung hingewiesen. Wohnen ist eine menschliche
Tätigkeit, die zusammen mit Objekten der Welt in Raum und Zeit
und zusammen mit andern Menschen stattfindet. Was wissen wir
über das Wohnen, das im Durchschnitt wohl etwa einen Drittel
unserer Lebenszeit ausmacht? Wie nicht zuletzt mein Vortrag, der
immer wieder in Allgemeinheiten abschweifen muss, zeigt: unglaublich
wenig. Das ist nicht unverständlich; denn Wohnen ist der
Prototyp des Privaten. Die Wohnpsychologen werden sich noch die
Zähne am Widerspruch ausbeissen, dass sie die Würde des
Menschen achten und gleichzeitig dessen ureigenste Tätigkeit
erforschen, also öffentlich machen wollen.
Dennoch dürfen wir uns wohl mit oberflächlichen
Bestimmungen des Wohnens nicht begnügen. Wie die Geschichte der
Wohnarchitektur zeigt, hat eine aus dem Handgelenk entworfene, sehr
zeitgebunden auf die Arbeitswelt des 19. und frühen 20.
Jahrhunderts reagierende Definition des Wohnens uns die grössten
Probleme gebracht, nämlich Wohnen sei die Erholung von den
MÜhen der Arbeit (CIAM, Corbusier, "Wohnmaschinen"-Idee). Sie
hat nämlich in Bauten - nicht verewigt, aber doch für viele
hundert Jahre - festgelegt, dass die Arbeitswelt und die Wohnwelt
zwei räumlich voneinander zu trennende Lebensbereiche seien; die
zwingende Folge davon war als dritter Bereich der Verkehr. (Damit
belege ich gewöhnlich mit einem gewissen unvermeidlichen
Zynismus meine These, dass Bauen sehr viel nachhaltiger das Leben des
Menschen bestimme als Gesetze, die man im Prinzip ändern
kann.)
9) Wohnumwelt und Arbeitswelt
Wie sieht denn die künftige Arbeitswelt aus? Niemand kann das
sagen. Die elektronischen Informationsverarbeitungsmaschinen werden
uns noch Überraschungen bringen. Ich gehe davon aus, dass sie
nicht mehr zu vermeiden sind. Wir würden sie besser in die Hand
nehmen, anstatt sie den Experten zu überlassen. Der Computer ist
nämlich analog dem Bauen und der Schrift eine dritte materielle
Manifestation des sozialen Gedächtnisses, nur noch viel
dynamischer als die beiden älteren.
Konkret und auf das Wohnen bezogen meine ich, dass wir gut daran
täten, die fast totale Trennung von Arbeits- und Wohnwelt
zielstrebig rückgängig zu machen, und dies notgedrungen
auch durch Bauen, bzw. durch Umbauen. Ich möchte damit keinem
Romantismus das Wort reden. Den Computer-Arbeitsplatz in der Wohnung
würde ich jedoch nicht als Regelfall anstreben. Eine relative
Trennung von Privatbereich und Öffentlichkeit scheint mir
lebenswichtig; und Arbeit grundsätzlich etwas ist
Öffentliches. Ich habe zu Beginn auf diese grundlegende und
notwendige Polarität hingewiesen.
Doch scheint mir denkbar, Quartiere zu fördern, welche
Wohnungen und Arbeitsplätze (nicht nur Dienstleistungen) in
enger Nachbarschaft aufweisen. Dasselbe gilt übrigens für
die Bildungsinstitutionen, die mit zunehmender Computerisierung ihre
militärisch inspirierte Zentralisierung verlieren könnten.
Heute werden in der Schweiz jährlich ungefähr ein Promille
der Gebäude abgebrochen und gänzlich neu gebaut. Das
heisst, wenn es so weiter geht, wir müssen an die tausend Jahre
warten, bis wir eine neue Lebensumwelt gebaut haben werden.
Vielleicht werden sich die Architekturschulen eines Tages sogar
entschliessen, Umbauen als eine zentrale Kompetenz ihrer Absolventen
zu pflegen.
10) Wohnökonomie
Warum sind in der Schweiz die Wohnungen so viel teurer als in
jedem anderen Land? Meine vereinfachende Antwort: weil wir nicht
darüber verfügen können. Die Schweiz hat die
höchste Mieter- bzw. die niedrigste
Eigentümer-Bewohner-Quote der Welt. Wir lassen anonyme
Gesellschaften für uns bauen. Ein Teil von ihnen gehört dem
Baugewerbe, wegen der Spekulation, der Arbeitsbeschaffung und der
Versicherungskassen; es ist klar, dass die raffiniertesten und
perfektesten Techniken und Einrichtungen gerade gut genug sind,
schliesslich lebt das Gewerbe davon umso besser, je teurer sie sind.
Wir sind im Begriff, die Sache noch einen Drehung höher zu
schrauben. Vorsichtige Schätzungen über den Einfluss der
zweiten Säule auf dem Immobilienmarkt lassen einen Zuwachs von
ungefähr einem Viertel erwarten an Kapital das jährlich zu
erstaunlich kleinen Zinsen angelegt werden muss und auf langfristigen
Kapitalgewinn spekuliert. Wir anonymisieren systematisch unsere
gebaute Umwelt, unser kollektives Gedächtnis.
Es gibt Beispiele von genossenschaftlichem Wohnungsbau, wo unter
Vermeidung der Perfektion und unter Gewinn von sehr viel
Verfügbarkeit nicht nur vorzügliche Wohnungen für
weniger als die Hälfte des landesüblichen Preises, sondern
zugleich im überschaubaren Rahmen für Gruppen von Familien
Wohnraum geschaffen wurde, der das Private und das Öffentliche
baulich realisiert.
11) Wohnungsnot?
Ich kann die Not des Einzelnen, der verzweifelt eine geeignete
Wohnung sucht, verstehen; was mir aber nicht in den Kopf will, ist
die Rede von der angeblichen Wohnungsnot, speziell in den grossen
Städten. Ich erinnere an die Statistiken: die Mehrzahl der
Wohnungen stehen heute in diesen Städten im Schichtbetrieb leer.
Die demographische Entwicklung und der Wohlstand werden diesen Trend
noch weiter fördern. In einigen städtischen Vororten steigt
die Leerwohnungsziffer bereits auf mehrere Prozent an, der
Landesdurchschnitt ist bei 0.8%; wobei man allgemein annimmt, dass
die offizielle Ziffer eine Unterschätzung ist. Allerdings sind
es fast ausschliesslich überteure Neuwohnungen die leerstehen;
und deren Vermieter sind noch nicht bereit, die Preise dem Markt
anzupassen. Aber bald einmal werden wir einen Mietermarkt haben, nach
vielen Jahrzehnten des Vermietermarktes eine ungewohnte Sache. Werden
sich die Wohnungsanbieter dann nicht nur im Preis, sondern auch in
der Qualität des Angebots den Mietern anpassen müssen? Was
werden die Mieter für Wohnungen bevorzugen? Werden sie mehr vom
Gleichen wollen: Perfektionismus und Grösse? Oder werden sie in
Kenntnis der Zusammenhänge zwischen Leben und Bauen Wohnungen
auswählen, die das Problematische der heutigen vermeiden?
12) Wohnerziehung, Wohnberatung,
Wohnhilfe
Hier ist wohl ein tüchtiger Schuss Pessimismus am Platz. Eine
Zeit lang habe ich, zwar mit einem gewissen Zögern, gemeint, die
Einrichtung der Wohnerziehung als Schulfach, vielleicht als Auseitung
des traditionellen Hauswirtschaftsunterrichts, wäre geeignet,
einige Verbesserungen herbeizuführen. Ich bin da
zurückhaltender geworden, weil die Schulen das Meiste, was sie
anfassen, über kurz oder lang ins Gegenteil verkehren. Es
wäre wohl unvermeidlich, dass die Lehrer dieses Faches (von
Ausnahmen will ich gern absehen), Normvorstellungen des richtigen
Wohnens verbreiten würden. Kämen dann unvermeidlicherweise
noch Benotungen hinzu, wäre das angerichtete Unheil erst recht
katastrophal. Ich habe jetzt mehrmals von einer Wohnbaugrammatik
gesprochen; aber ich habe nicht an die Schulgrammatik einer Sprache
als Vorbild gedacht, sondern eher an den Umstand, dass die
Sprachgrammatik die Schulgrammatik laufend widerlegt. So richte ich
mich lieber auf eine unsystematische Verbreitung von Kenntnisses
über das Wohnen, wie sie auch in diesem Vortrag geschieht und
wie sie wohl im Anschluss daran von Ihnen allen weitergegeben werden,
und zwar Einsichten, durch Ihre eigene Erfahrung gefiltert und
geläutert.
Ich stelle mir Vorgänge vor wie diese:
Sie beobachten, dass der fertiggemachte Kinderspielplatz zwar eine
Augenweide ist, aber Kinder nur einen engen Altersgruppe anzieht, und
auch diese eher zu Ritualen veranlasst als zu Spielen herausfordert.
Dann graben Sie mal irgendwo an einer geeigneten Stelle ein Loch in
den Boden und lassen eine alte Schaufel liegen, und beobachten
unauffällig, was nun die Kinder damit machen. (Versuchen sie
noch zu erreichen, dass der Abwart von vis-a-vis es nicht wieder
zuschaufelt!)
Oder Sie wundern sich (wenn Sie ein städtischer
Wohnungsbewohner sind) bei einem Besuch in einem älteren
Landhaus: zuerst über die Verschwendung, die darauf verwendet
wurde, zwei vollständige Wohnzimmer einzurichten: einen Salon
und ein Stübli. Später, wenn sie etwas länger,
vielleicht sogar über die Nacht geblieben sind, über die
eindrückliche und sinnvolle familiäre Organisation, die
durch diesen simplen zweiten Raum entsteht: da wird hier
präsentiert, dort gespielt oder gebastelt, dann hier eine Feier
abgehalten und dort gerauft, wie es sich für ein gewisses Alter
gehört.
Wenn es zufällig geregnet hat, werden Sie in dem Landhaus
auch die Bedeutung leerer Estriche oder Treppenhäuser,
überhaupt von sog. Sekundärraum erkannt haben, weil sich
dort Tätigkeiten ("Wohnen") ausbreiten konnte, das in der
durchgeplanten modernen Stadtwohnung keinen Platz findet.
Oder Sie kennen ein Haus oder sogar eine Wohnung mit Anbauten,
Fortsätzen. Wie die Familie gewachsen ist, die Grossmutter
dazukam oder ein kleines Geschäft aufgetan wurde, hat man
angebaut (und, oh Wunder, die Baugesetze der Gemeinde haben es noch
erlaubt!) - Anschauungsunterricht, wie Familienstrukturen und gebaute
Strukturen einander stützen und fördern.
Eine der wichtigsten Einsichten, die ich verbreiten würde,
wäre auch die folgende: wenn Bauen eine Sprache ist, die man
beim Wohnen unwillkürlich spricht - ist dann nicht allein wohnen
ein freiwilliges Verstummen, selbstauferlegte Sprachlosigkeit?
Alleinwohnen ist eigentlich eine Perversion des Wohnens. Ich verweise
zurück auf die Angaben zur Statistik über das Wohnen aus
der Volkszählung.
Schlussbemerkungen
Ich komme zum Schluss. Ein simples Resume meiner Ausführungen
kann ich Ihnen nicht geben. Vielleicht haben Sie bei manchen meiner
Beispiele gedacht: wie können wir es besser machen, was sollen
wir denn tun, dass es richtig ist? Solche Frager muss ich
frustrieren. Ich fürchte dass das Wohnunheil des 20.
Jahrhunderts zu einem schönen Teil dem Mechanismus zu verdanken
ist, dass sich einige Leute angemasst haben, zu wissen wie es am
besten sein müsse. Und diese Fachleute haben dann mit einem
missionarischen Eifer ihre "richtigen" Vorstellungen in Gebautes
umgesetzt, an dem wir jetzt leiden und wohl noch einige Zeit leiden
werden.
Ich meine, dass wir einen andern "Mechanismus" brauchen und sehe
einen Schlüssel in sinnvoll angewandeter Sozialwissenschaft,
darunter Wohnpsychologie. Bauen und Wohnen beruhte während
Jahrtausenden auf Tradition, man wusste nicht, warum man es so oder
anders machte, man hatte es einfach immer so gemacht; und nur ganz
langsam wirkten sich die Effekte des Gebauten auf den Menschen im
Rückwirkungskreis auch wieder auf die Änderung der
Bautradition aus.
Durch die wissenschaftlich-technischen Errungenschaften haben wir
diesen Rückkoppelungskreis kurzgeschlossen. Wir können
jetzt rein physisch fast alles bauen, Kunstwerke unserer
Gestaltungslust oder Meisterleistungen unseres ökonomischen
Karussells in die Welt stellen. Bloss haben wir dabei die Menschen
vergessen. Die Technik können wir nicht abschaffen (es sei denn
durch eine totale Katastrophe); also müssen wir wohl auf der
Menschseite nachziehen (ob wir wollen oder nicht): die Rolle des
Menschen in der gebauten Lebenswelt auch wissenschaftlich erkunden
und Konsequenzen für das Bauen und Wohnen daraus ziehen.
Was wir brauchen, ist eine explizite Wohnbaugrammatik.
Natürlich konnten und können Menschen ohne
Grammatikkenntnisse sprechen; hochentwickelte Sprachen bedürfen
aber der Unterstützung durch eine bewusste Grammatik. Der
hochentwickelten Bautechnik haben wir noch keine adäquate
Wohngrammatik zur Seite zu stellen. Diejenigen, die bauen,
müssen lernen, auch aus der Kenntnis einer adäquaten
Wohngrammatik heraus zu bauen; diejenigen die Wohnen, müssen ihr
Wohnen wnigstens zum Teil verstehen, damit sie von den Bauenden das
ihnen gemässe Gebaute verlangen und dann das Gebaute für
sich selbst vollenden können. Ich hoffe, dass meine
exemplarischen Blicke in ein psychologisches Verständnis des
Wohnens Sie ahnen lässt, dass eine solche Wohnbaugrammatik
möglich und vermutlich nötig ist, dass auf dem Wege dazu
aber noch sehr viel sichere Erkennntis fehlt. Wenn sich die Elemente
einer Wohnbaugrammatik, von denen ich Ihnen nur einige und
vorläufige präsentieren konnte, vertiefen und verbreiten
werden, besteht eine Chance, dass Familien wieder echte und gesuchte
Wohngemeinschaften werden.
Wohngemeinschaft Familie,
Themenliste zur Diskussion
Die "Wohngemeinschaft" ist eine zeitgemässe Sehnsucht,
vielleicht auch ein Symptom für Fehlentwicklungen im Wohnen von
Familien. Gemeinsam mit den Teilnehmern möchte ich an der Tagung
über verschiedene Aspekte des Wohnens nachdenken, unter Beizug
sozialwissenschaftlicher Erkenntnis und mit Blick auf
gesellschaftspolitische Perspektiven. Anstelle von Familien-Romantik
und Wohngemeinschafts-Utopie können wir vielleicht einige
realistische Impulse setzen. Nebenbei aber auch dem Einzelnen
dienlich sein.
Wohnstrukturen und Familiendynamik
Die Wohnung ist ein "Gefäss" für die Familie. Sie kann
stabilisieren und fördern. Durch bestimmte Bauformen
begünstigen oder hemmen wir familiäres Leben und
familiäre Entwicklung.
Familien und Wohnungen im Verband (Nachbarschaft, Quartier,
Stadt)
Familien wie Wohnungen sind zugleich autonome und umwelteingebette
Gebilde, die untereinander in Wechselwirkung stehen. Durch
verschiedene Bauformen fördern oder hemmen wir das
Beziehungsnetz oder die Vereinsamung.
Jugendliches Wohnen
Dank unserem Wohlstand können heute die meisten Jugendlichen
den Übergang zur Selbständigkeit früh mit der eigenen
Wohnung markieren: Sinn und Unsinn und mögliche
Alternativen.
Kindgemässes Wohnen
Es gibt Häuser, die zwingen Mutter und Kind entweder zusammen
oder sie stehen trennend dazwischen. Unser Bauen für Kinder
zeigt, dass das Jahrhundert des Kindes ein Jahrhundert gegen das Kind
geworden ist.
Wohnen im höheren Alter
Alterswohnungen machen Menschen älter. Einmal mehr haben rein
technische Problemlösungsversuche mehr Probleme gebracht als
gelöst.
Kreatives Wohnen
Volkwirtschaftlich ist die Wohnung ein Konsumgut, für den
Bewohner ist sie jedoch eine Investition: sie kann ihn und die
Familie zur Entwicklung der Persönlichkeit herausfordern, sofern
sie Eigenschaften wie Veränderbarkeit und Verfügbarkeit
aufweist.
"Schöner Wohnen"
Wie wissen die Architekten, ob Wohnungen gut oder schelcht sind?
Wie wissen es die Bewohner? Die Wohnung bietet Spannungsfelder:
Dieser Teil - jener Teil, das Äussere - das Innere, das Eigene -
das Fremde.
Wohnungstechnik und Wohntechnik
Die Politik beschäftigt sich mit der Wohnung als Objekt und
als Produkt verschiedener Techniken des Bauens, des Einrichtens etc.;
für den Bewohner ist aber die Wohnung selber eine Technik,
nämlich eine Art Prothese bei der Tätigkeit des Wohnens.
Zurück zur Natur oder welche und wessen Technik?
Wohnumwelt und Arbeitswelt
Man übersieht leicht, dass die gegenwärtige Trennung
zwischen Arbeitswelt und Wohnumwelt weniger als 200 Jahre alt und
vermutlich eine vorübergehende Erscheinung ist. Eine
künftige Lebenswelt, die Arbeit und Freizeit umfasst,
könnte an einer sonderbaren, auf Trennung von Arbeit und Wohnung
gebauten Welt scheitern.
Wohnökonomie
Warum sind neue Wohnungen so teuer? Muss das so sein? Was hat
für wen welche Bedeutung?
Wohnungsnot?
Die meisten Wohnungen stehen heute "im Schichtbetrieb" leer.
Dennoch spricht man von "Wohnungsnot" und ruft nach staatlichen
Eingriffen. Demographische Entwicklungen und pschosoziale
Perspektiven verlangen neue Zielsetzungen gegen das
Immer-mehr-und-immer-grösser.
Wohnerziehung, Wohnberatung, Wohnhilfe
Richtiges und falsches Wohnen gibt es nicht, aber viele Varianten.
Wohnen ist eine grundlegende menschliche Tätigkeit; sie kommt
nicht von allein, man kann sie aber auch nicht einfach unterrichten
oder anweisen. Klüger wohnen als Rahmenziel.
Diese Liste von Themen und thesenartigen Hinweisen bildet
voraussichtlich das Grundgerüst des Referats. Vielleicht kann
ich später zu jedem Stichwort eine Seite mit weiteren Thesen und
Hinweisen vorbereiten, als Grundlage der Gruppenarbeit. Denkbar
wäre aber auch, dass die Gruppenleiter solche Unterlagen
bereitstellen.
Bern, 21.8.84 Alfred Lang
Top of Page